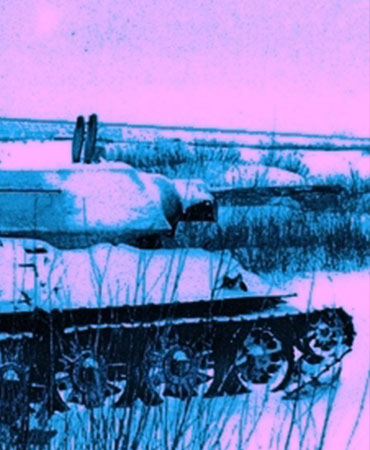Der Garten
Ein Garten spiegelt die bewegte Geschichte einer Kleinstadt im 20. Jahrhundert.
Vera erzählt Jurow als erstes, dass ich Nachkomme der Familie bin, der dieser Garten gehört hat, und dass ich ihn zum ersten Mal betreten möchte.
Ich frage Jurow, Vera übersetzt: „Seit wann haben Sie diesen Garten?“ „Mein Vater hat ihn 1946 bekommen. Seit mein Vater tot ist, bearbeite ich ihn.“
Ich merke Jurow an, dass er nicht ungern erzählt; vielleicht braucht man nur anzutippen, um etwas von ihm zu erfahren. Ich frage: „Erinnern Sie sich
noch, wie der Garten 1946 aussah?“ „Sicher. Er war noch unzerstört; und schön: zwei Lauben, ein Gartenhaus, Spaliere und Pergolen. Dazu eine Menge
Obstbäume und Beerenbüsche. Die Wege waren mit Kies bestreut und die Beete und Rasenflächen mit Steinen eingefasst. Es herrschte eine große Ordnung.“
Vera fragt etwas naiv: „Und wer hat die Ordnung zerstört?“ „Na, wer schon? Wir! Wir Russen. – In der Stadt war damals überhaupt noch viel mehr
erhalten als heute, es war das meiste in gutem Zustand. Die Leute sind damals rücksichtslos mit allem umgegangen. Wenn ihnen etwas nicht passte,
haben sie es rausgerissen und sich aus anderen Häusern Sachen geholt, die ihnen besser gefielen. – Hier im Haus zum Beispiel, da hatten wir
eine Heizung, die wollten wir nicht; da haben wir sie ausgebaut und uns aus einem anderen Haus eine neue geholt. Die passte aber nicht.
Da haben wir beide rausgeschmissen und Öfen eingebaut. Vieles ist kaputt gemacht worden damals!“ Jurow ist mit seinem Bericht in Fahrt und erzählt,
was ihm die Erinnerung eingibt. „Mir fällt da eine Geschichte ein: Ein paar Russen hatten einen deutschen Kachelofen so überheizt, dass er glühte.
Sie nahmen einen Eimer kaltes Wasser und schütteten ihn über den Ofen. Da zersprangen seine Kacheln in tausend Stücke, und der Ofen war nicht mehr
zu gebrauchen. – Ja, hier in Gerdauen ist viel Schönes zerstört worden. Und wo man Neues gebaut hat, hat es schlechte Qualität.“ Jurow hat die
Stirn in Falten gelegt und schüttelt zuletzt sogar den Kopf bei dem, was er erzählt, man merkt ihm seine Zerknirschung an.
Die Nachbarin sagt entschuldigend: „Wir waren aber bis Anfang der sechziger Jahre sicher, dass wir hier wieder weg müssen und die Deutschen zurückkommen.“ Mir geht dabei durch den Kopf, dass dieser Zeitpunkt tatsächlich eine Bedeutung haben muss, denn ich habe gelesen, und es wurde mir in Gerdauen von mehreren Russen bestätigt, dass große Teile der Stadt bis in die sechziger Jahre ziemlich gut erhalten waren und erst danach der rapide Verfall und der großflächige Abriss begannen. Offensichtlich machten sich die Sowjets erst, als sie sich ihres Besitzes sicher waren, an seine Zerstörung.
Aber wir werden aus dem Thema gerissen durch einen nassen Windstoß, der durchs Haus fegt und uns vom Eingang weg in eine andere Ecke des Flures treibt. Jurow entschuldigt sich, weil er uns nicht in seine Wohnung bittet, aber er sei gerade am Renovieren. Ich frage ihn, wie lange er schon in diesem Haus wohnt.
„Seit 1946. Gleich als unsere Familie nach Gerdauen kam, sind wir eingezogen. Ich bin Jahrgang 1928, ich war damals 18. Mein Vater leitete die Schlossmühle hier ganz in der Nähe, da hatte er es nicht weit zur Arbeit. Damals arbeiteten noch viele Deutsche in der Mühle. Als sie später weg mussten, war er dagegen. Denn sie waren so fleißig, dass er nicht auf sie verzichten wollte. 1947 war die Mühle vorübergehend Möbellager, mit Möbeln, die man aus den Häusern geholt hatte. Von denen hat sich mein Vater ein Klavier genommen. Dann hat er uns Klavierunterricht geben lassen, meiner jüngeren Schwester und mir, bei einer deutschen Klavierlehrerin. Die hat uns viel beigebracht, deshalb kann ich heute noch Klavier spielen. Und meine Schwester ist sogar Musiklehrerin geworden. – Ich erinnere mich auch noch an den Namen der Klavierlehrerin. Sie hieß Erna.“
„Erinnern Sie sich noch an andere Deutsche aus jener Zeit?“ „Ja, da war eine Gruppe Jungs, sie mussten als Elektriker arbeiten. Die Namen waren Kurt, Hans, Koska und noch andere. Ich habe auch mal mit ihnen gearbeitet. Ich bin immer gut mit ihnen ausgekommen.“
Der Regen hat aufgehört, und wir gehen langsam durch das feuchte Gras, das über den Weg wuchert, in Richtung Garten. Ich will aber noch etwas von damals wissen und frage Jurow, was aus der Schlossmühle wurde. „Nachdem mein Vater aufgehört hatte, kam ein anderer Mühlendirektor. Die Mühle war ja Hauptmühle, das heißt, ihre Erzeugnisse wurden nach Russland ausgeführt.“ (Jurow selbst unterscheidet hier Ostpreußen und Russland.) „Als der neue Mühlendirektor 1980 starb, fand man keinen Nachfolger für ihn. Da hat man die Mühle geschlossen. Jetzt ist sie Ruine.“
Der Zugang zum Garten ist stark gesichert, über dem Lattenzaun hat Jurow ein Gestell mit Maschendraht angebracht, das Tor ist durch ein Vorhängeschloss versperrt, das er jetzt öffnet. Jurow lässt uns eintreten. Unser Weg durch den Garten ist zum guten Teil ein Waten durch Wildwuchs. Ich zähle fünf erhalten gebliebene Apfelbäume, Jurow zeigt zusätzlich auf die Reste zweier Pflaumenbäume. Neue Bäume sind nicht gepflanzt. Sonst gibt es ein großes Stück Acker mit dem landesüblichen Halbe-halbe-Verhältnis von Kartoffeln und Unkraut. Jurow zeigt auf eine Kürbisstaude: Dort war ein Brunnen, den er mal zugeschüttet hat.
Ein neuer Regenschauer zwingt uns, Zuflucht unter dem größten der alten Apfelbäume zu suchen. Sein dichtes Blätterdach wölbt sich fast bis aufs Gras. Hier hat sich Jurow einen Sitzplatz eingerichtet mit einem Tisch und einem schmalen Bänkchen, Tisch und Bank sind mit Äpfeln belegt. Und während wir so dastehen in dem, was mal der Garten meiner Großeltern war, fängt dieser Mann in seinem, in unserem Garten auf seine gutartige, redselige Weise zu schwärmen an von den Äpfeln, die er erntet. Unter allen guten Äpfeln, sagt er schließlich, ragen die eines Baumes hervor, nämlich desjenigen, unter dem wir gerade stehen. Seine Früchte sind groß und leuchtend goldgelb und wenn man sie nach dem Pflücken noch eine Weile liegen lässt, werden sie immer wohlschmeckender und bekommen am Ende ein ganz unvergleichliches Aroma. Als er dieses schildert, passiert es, dass mir trotz des schützenden Blätterdaches die Augen feucht werden, denn er schwärmt von den Äpfeln, in einer anderen Sprache zwar, doch mit den gleichen Worten, mit denen, sehr fern von hier, meine Mutter von den Früchten dieses Paradiesgartens ihrer Kindheit erzählte. „Aber auch die Größe der Äpfel hat im Laufe der Jahre abgenommen“, sagt Jurow; und als der Regen aufhört, legt er uns zum Abschied jedem zwei Äpfel in die Hand.
Die Nachbarin sagt entschuldigend: „Wir waren aber bis Anfang der sechziger Jahre sicher, dass wir hier wieder weg müssen und die Deutschen zurückkommen.“ Mir geht dabei durch den Kopf, dass dieser Zeitpunkt tatsächlich eine Bedeutung haben muss, denn ich habe gelesen, und es wurde mir in Gerdauen von mehreren Russen bestätigt, dass große Teile der Stadt bis in die sechziger Jahre ziemlich gut erhalten waren und erst danach der rapide Verfall und der großflächige Abriss begannen. Offensichtlich machten sich die Sowjets erst, als sie sich ihres Besitzes sicher waren, an seine Zerstörung.
Aber wir werden aus dem Thema gerissen durch einen nassen Windstoß, der durchs Haus fegt und uns vom Eingang weg in eine andere Ecke des Flures treibt. Jurow entschuldigt sich, weil er uns nicht in seine Wohnung bittet, aber er sei gerade am Renovieren. Ich frage ihn, wie lange er schon in diesem Haus wohnt.
„Seit 1946. Gleich als unsere Familie nach Gerdauen kam, sind wir eingezogen. Ich bin Jahrgang 1928, ich war damals 18. Mein Vater leitete die Schlossmühle hier ganz in der Nähe, da hatte er es nicht weit zur Arbeit. Damals arbeiteten noch viele Deutsche in der Mühle. Als sie später weg mussten, war er dagegen. Denn sie waren so fleißig, dass er nicht auf sie verzichten wollte. 1947 war die Mühle vorübergehend Möbellager, mit Möbeln, die man aus den Häusern geholt hatte. Von denen hat sich mein Vater ein Klavier genommen. Dann hat er uns Klavierunterricht geben lassen, meiner jüngeren Schwester und mir, bei einer deutschen Klavierlehrerin. Die hat uns viel beigebracht, deshalb kann ich heute noch Klavier spielen. Und meine Schwester ist sogar Musiklehrerin geworden. – Ich erinnere mich auch noch an den Namen der Klavierlehrerin. Sie hieß Erna.“
„Erinnern Sie sich noch an andere Deutsche aus jener Zeit?“ „Ja, da war eine Gruppe Jungs, sie mussten als Elektriker arbeiten. Die Namen waren Kurt, Hans, Koska und noch andere. Ich habe auch mal mit ihnen gearbeitet. Ich bin immer gut mit ihnen ausgekommen.“
Der Regen hat aufgehört, und wir gehen langsam durch das feuchte Gras, das über den Weg wuchert, in Richtung Garten. Ich will aber noch etwas von damals wissen und frage Jurow, was aus der Schlossmühle wurde. „Nachdem mein Vater aufgehört hatte, kam ein anderer Mühlendirektor. Die Mühle war ja Hauptmühle, das heißt, ihre Erzeugnisse wurden nach Russland ausgeführt.“ (Jurow selbst unterscheidet hier Ostpreußen und Russland.) „Als der neue Mühlendirektor 1980 starb, fand man keinen Nachfolger für ihn. Da hat man die Mühle geschlossen. Jetzt ist sie Ruine.“
Der Zugang zum Garten ist stark gesichert, über dem Lattenzaun hat Jurow ein Gestell mit Maschendraht angebracht, das Tor ist durch ein Vorhängeschloss versperrt, das er jetzt öffnet. Jurow lässt uns eintreten. Unser Weg durch den Garten ist zum guten Teil ein Waten durch Wildwuchs. Ich zähle fünf erhalten gebliebene Apfelbäume, Jurow zeigt zusätzlich auf die Reste zweier Pflaumenbäume. Neue Bäume sind nicht gepflanzt. Sonst gibt es ein großes Stück Acker mit dem landesüblichen Halbe-halbe-Verhältnis von Kartoffeln und Unkraut. Jurow zeigt auf eine Kürbisstaude: Dort war ein Brunnen, den er mal zugeschüttet hat.
Ein neuer Regenschauer zwingt uns, Zuflucht unter dem größten der alten Apfelbäume zu suchen. Sein dichtes Blätterdach wölbt sich fast bis aufs Gras. Hier hat sich Jurow einen Sitzplatz eingerichtet mit einem Tisch und einem schmalen Bänkchen, Tisch und Bank sind mit Äpfeln belegt. Und während wir so dastehen in dem, was mal der Garten meiner Großeltern war, fängt dieser Mann in seinem, in unserem Garten auf seine gutartige, redselige Weise zu schwärmen an von den Äpfeln, die er erntet. Unter allen guten Äpfeln, sagt er schließlich, ragen die eines Baumes hervor, nämlich desjenigen, unter dem wir gerade stehen. Seine Früchte sind groß und leuchtend goldgelb und wenn man sie nach dem Pflücken noch eine Weile liegen lässt, werden sie immer wohlschmeckender und bekommen am Ende ein ganz unvergleichliches Aroma. Als er dieses schildert, passiert es, dass mir trotz des schützenden Blätterdaches die Augen feucht werden, denn er schwärmt von den Äpfeln, in einer anderen Sprache zwar, doch mit den gleichen Worten, mit denen, sehr fern von hier, meine Mutter von den Früchten dieses Paradiesgartens ihrer Kindheit erzählte. „Aber auch die Größe der Äpfel hat im Laufe der Jahre abgenommen“, sagt Jurow; und als der Regen aufhört, legt er uns zum Abschied jedem zwei Äpfel in die Hand.
Als Sowjetoffizier hat er die Stadt erobert, nun lebt er in ihr und berichtet. Oral history und Interview-Erzählung zugleich.
Mehr lesen >>
Mehr lesen >>